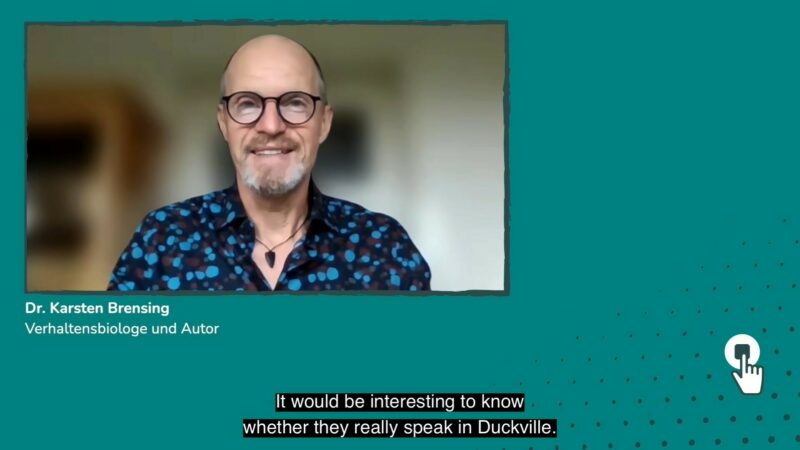- Menü
- Heute
-
Nächste Veranstaltung
Vorlese-Stunde mit den "Omas gegen Rechts"
in der LESEREISonderausstellung
ICH, DAS TIER
Dauerausstellung
Erlebnisraum GRIMMWELT
Interview mit Dr. Karsten Brensing, Verhaltensbiologe und Autor
© GRIMMWELT Kassel
Die Sonderausstellung »ICH, DAS TIER. Vom bösen Wolf bis Donald Duck – Tiere im Comic« in der GRIMMWELT begibt sich vom 23. August 2025 bis zum 12. April 2026 zusammen mit dem Kunsthistoriker, Comic-Experten und Kurator Dr. Alexander Braun auf die Fährten von Tierfiguren in der Comic-Kultur.
Der Erzählkosmos sowohl von Comics, als auch Märchen, lebt letztlich von der Vielfalt der Tierwelt als scheinbar endloser Quelle für Inspiration. In der Ausstellung regen mehr als 200 Exponate die Besucher*innen an, sich mit den unterschiedlichen Tierdarstellungen auseinanderzusetzen – und mit der Frage, was sich hieraus über die tatsächlichen Mensch-Tier-Beziehungen ableiten lässt.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist geprägt von Emotionen, kulturellen Deutungen und gesellschaftlichen Dynamiken. Eine Videoinstallation der Filmemacherin Hannah Leonie Prinzler zeigt in der Ausstellung verschiedene Perspektiven auf Mensch-Tier-Beziehungen. In neun Einzelinterviews sowie einer Film-Collage kommen ganz unterschiedliche Erfahrungen und Aspekte zur Sprache – Tierbilder in Märchen, Mythen und im Comic; Tiere im Tierpark und im urbanen Raum, als Content im Internet oder als Nahrungsmittel. Die Installation versammelt Expertisen aus der Kunst und Kunstwissenschaft, Biologie, Verhaltens- und Erzählforschung.
Mit dem Verhaltensbiologen und Autor Dr. Karsten Brensing sprachen wir in diesem Kontext über Mensch-Tier-Beziehungen, den menschlichen Blick auf Tiere und über Missverständnisse im Miteinander.
© GRIMMWELT Kassel | Foto: Nicolas Wefers
Herr Brensing, an welche tierischen Helden Ihrer Kindheit erinnern Sie sich besonders eindrucksvoll?
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war es zweifellos Flipper, der Delfin aus dem Fernsehen, der mich am stärksten geprägt hat. Er war das wichtigste Tier meiner frühen Jahre - so sehr, dass ich später Meeresbiologie studierte und Delfine erforschte. Auch wenn ich im Alltag weit mehr Kontakt zu Hunden hatte – Flipper war das Tier, das mich faszinierte und neugierig auf das Leben im Meer machte.
Doch die wirklich prägenden Erfahrungen verbinde ich mit einem kleinen Pudel namens Ricke, dem Hund meiner Kindheit. Durch ihn verstand ich erstmals, dass Tiere Persönlichkeiten sind. Er stand mir unendlich viel näher als jede Fernsehfigur – auch näher als Lassie, die zwar ebenfalls wichtig war, aber eben eine Fantasiegestalt.
Was ist Ihnen in Bezug auf Mensch-Tier-Beziehungen wichtig?
Entscheidend in jeder Mensch-Tier-Beziehung ist für mich der Dialog. Ein Tier, das Teil unserer Familie wird, tritt in eine soziale Gemeinschaft ein. Hunde eignen sich dafür besonders gut: Wir übernehmen Verantwortung für sie, und sie sind für uns da. Dieses Miteinander ist kein modernes Phänomen, sondern eine jahrtausendealte Tradition. Doch es funktioniert nur dann wirklich, wenn wir den Tieren auch zuhören. Ein Spaziergang mit dem Hund ist dafür ein gutes Beispiel: Lasse ich ihn entscheiden, ob wir nach links oder rechts gehen, entsteht ein echter Dialog. Gebe ich nur Kommandos, bleibt es ein Machtverhältnis – keine Beziehung.
Auch Wildtiere lassen Dialoge zu. Vögel etwa reagieren auf Pfeifen, manche warten sogar, bis wir „fertig“ sind, bevor sie selbst wieder rufen. Solche Erfahrungen zeigen: Wir teilen mit Tieren weit mehr, als uns bewusst ist. Als Verhaltensbiologen prüfen wir kognitive Fähigkeiten in Tests, die wir genauso an Menschen durchführen könnten. Tiere denken und fühlen wie wir, weil die Mechanismen des Geistes lange vor uns entstanden sind.
Wie würden Sie die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Tieren und Menschen beschreiben?
Besonders spannend ist die Frage nach Metakognition, also dem Denken über das eigene Denken. Experimente – etwa mit Ratten oder Bienen – zeigen, dass auch Tiere in der Lage sind, über ihr Wissen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die zum Beispiel auch ihr eigenes Unwissen berücksichtigen. Damit verschwimmen die Grenzen, die wir Menschen einst so scharf gezogen haben.
Wie würden Sie die Rolle(n) beschreiben, die Tiere in Ihrem Leben einnehmen?
Meine persönliche Haltung zu Tieren ist zweigeteilt. Privat sind sie für mich Familienmitglieder, beruflich Forschungsobjekte. Doch auch als Wissenschaftler sehe ich, wie problematisch die Sprache ist, mit der wir über Tiere reden. Begriffe wie »Nutztier« oder »Schlachtvieh« reduzieren Lebewesen auf Funktionen. Ebenso irreführend ist die alte Vorstellung vom »Instinkt«, der Tiere angeblich von uns trennt.
Heute wissen wir: Menschen sind keineswegs immer rational, und den Instinkt hat die Wissenschaft Jahrzehnte gesucht, aber nicht gefunden. Tiere und somit auch wir handeln auf Basis von Denken, Gefühlen und Erfahrungen.
Wann und inwiefern werden Tiere zu Projektionsflächen menschlicher Gedanken, Gefühle und Eigenschaften?
Die Menschheit hat Tiere immer auch als Projektionsflächen genutzt. Fabeln oder Comics wie diejenigen aus Entenhausen spiegeln menschliches Sozialleben, Charaktere und Persönlichkeitsmerkmale. Und tatsächlich: Unterschiede in der Persönlichkeit – ob mutig, ängstlich oder neugierig – gibt es nicht nur bei uns, sondern auch bei Fliegen, Krebsen oder Hunden.
Doch Vorsicht ist geboten: Während Entenhausen ein spielerischer Spiegel unserer Gesellschaft ist, ist das Bild vom »bösen Wolf« ein fatales Beispiel. Hier übertragen wir menschliche Moral auf Tiere – und stempeln sie zu Feinden ab. In Wahrheit sind Wölfe hochsoziale Tiere, fürsorglich und kooperativ.
Denken wir an Donald Duck, haben wir ihn oft nicht nur vor Augen, sondern direkt auch im Ohr: Was gibt es aus der Wissenschaft zum »Schnattern« von Enten zu sagen, über ihr Sprachsystem oder auch allgemeiner über die Komplexität von tierischen Sprachsystemen?
Auch beim Thema Sprache lernen wir ständig dazu. Tiere verfügen über ein viel größeres Vokabular als lange angenommen, manche Vogelarten nutzen sogar Grammatik. Untersuchungen zeigen, dass wir Menschen in der Lage sind, tierische Lautäußerungen universell zu deuten – Aggression oder Gelassenheit können wir auch bei Fröschen oder Elefanten erkennen. Diese Fähigkeit ist hunderte Millionen Jahre alt und belegt, wie tief Kommunikation in der Evolution verwurzelt ist. Moderne Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz, eröffnen uns zudem neue Wege, tierische Laute präziser zu analysieren. Vieles, was uns heute banal erscheint – etwa das Quaken von Enten –, könnte sich in Zukunft als hochdifferenzierte Form von Kommunikation erweisen.
Was können wir daraus für die Beziehungen mit Tieren lernen?
Es zeigt sich: Tiere sind keine Gegenstände, keine bloßen Instinktbündel und keine Märchenfiguren. Sie sind denkende, fühlende Lebewesen, mit denen wir in Beziehung treten können – im Alltag, in der Forschung und in unseren Geschichten. Ob Hund oder Delfin, ob Fliege oder Wolf: In ihrem Verhalten erkennen wir Aspekte von uns selbst.
Und genau darin liegt der eigentliche Reiz des Dialogs zwischen Mensch und Tier – in der Erkenntnis, dass wir nicht so verschieden sind, wie wir lange glaubten.
© GRIMMWELT Kassel | Foto: Nicolas Wefers